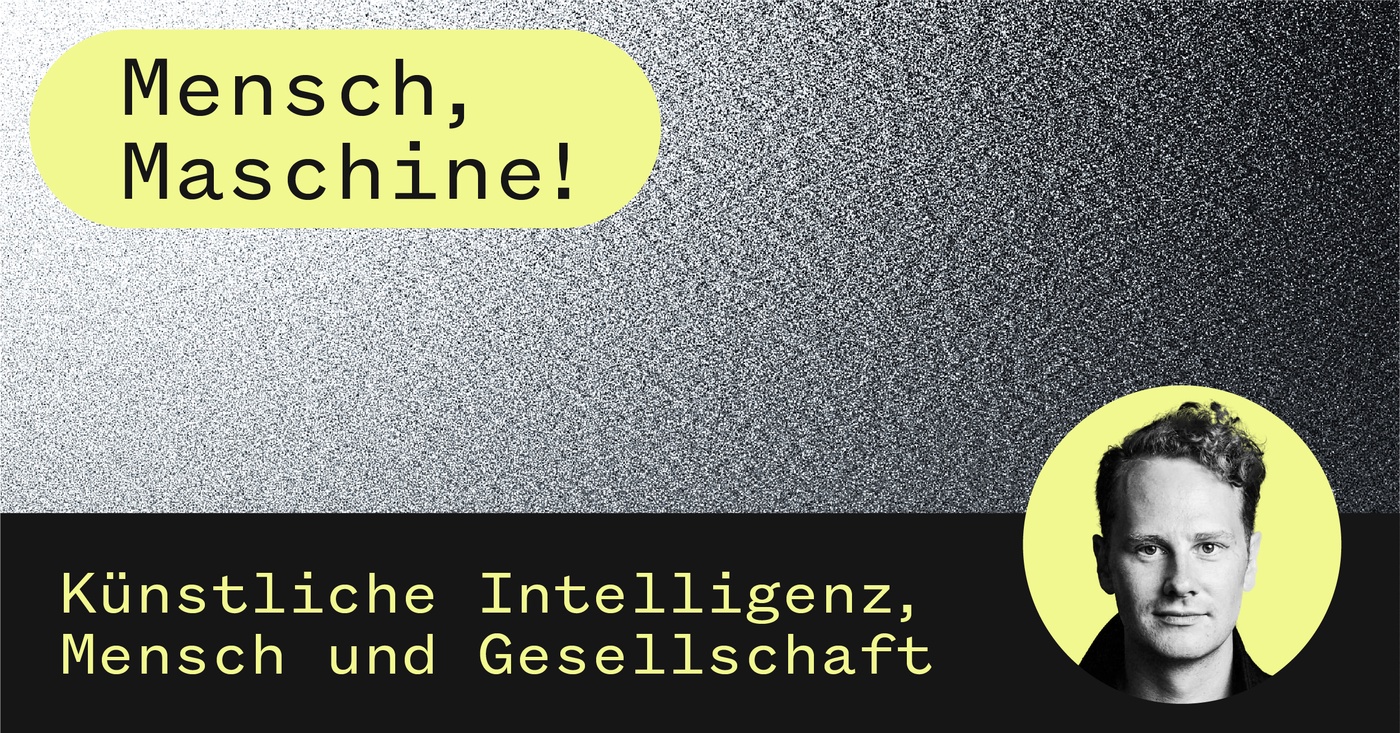GPT & Co (6/6)— Reasoning: Was fehlt noch zum Artificial General Assistant?
Sprachmodelle sollen bald alles können, was Mitarbeiter im Homeoffice können. AutoGPT & Co zeigen schon jetzt, was möglich ist, wenn die künstlichen Assistenten selbst Aufgaben abarbeiten, Mails schreiben und Konten managen. Aber bisher muss ein Mensch jede Aktion gegenprüfen, weil die für LLMs typischen Halluzinationen in der Interaktion mit der realen Welt zur Gefahr werden. Doch lassen sich diese verhindern? Können wir wirklich zuverlässige Sprachmodelle schaffen, die Ärztinnen, Anwälte und Verwaltungsbeamte ersetzen können. Nur, wenn wir verschiedene KIs miteinander kreuzen. Sogenannte „hybride KI“ könnte viele Jobs ersetzen — wenn sie gelingt.